
Einen idyllischeren
Ort als den Lindenplatz findet man in Brettach kein zweites Mal mehr. Weit
genug entfernt vom Ortsdurchgangsverkehr, umsäumt von historischen
Toren und Mauern, einem Kinderspielplatz, alten renovierten Häusern
und zwei mächtigen Bäumen - einer Kastanie und einer Ulme-, bietet
dieser Platz mit der Kirche im Hintergrund ideale Voraussetzungen für
Ruhe und Erholung und für Feste.
Es gibt nicht viele Dörfer,
wo eine solche Fülle von typischen Kennzeichen des früheren dörflichen
Lebens als Ensemble erhalten ist. Es sind dies die Kirche, die Friedhofsmauer
mit den beiden Eingängen - dem Haupt- und dem Pesttor-, das Pfarrhaus,
die Linde, der Lindenhof mit Umfassungsmauer und Renaissanceportal, eines
der beiden Gemeindebackhäuser, Armenhäuschen -gleichzeitig Aufenthaltsraum
für den Nachtwächter-, die als heilkräftig geltende Ouelle
in einem imposanten Tonnengewölbe und schließlich sogar das
alte Gemeindegefängnis, in dem früher die hoffentlich wenigen
kleineren Missetäter für kurze Zeit eingesperrt waren.
Es ist nur allzu verständlich,
daß Gemeinderat und Verwaltung und der Heimatgeschichtliche Verein
Langenbrettach e.V. sehr daran interessiert sind, die ganze Fülle
dieser dörflich-historischen Kleinodien zu erhalten.
Der Heimatgeschichtliche Verein
hat in den letzten Jahren bei der Ausgrabung und Renovierung von Kirchbrunnan
und Gewölbe die Hauptarbeit geleistet und bei der Wiedererrichtung
von Kirchhofsmauer und Pesttor beratend mitgewirkt.
Die Gemeinde Langenbrettach wird
in den kommenden Jahren im Rahmen der Dorfsanierung im Bereich des Lindenplatzes
das Notwendige erneuern und das historisch Gewachsene erhalten.
DER KIRCHBRUNNEN
Der unterirdische Gang
Vor ca 5 Jahren
beschloß der Heimatgeschichtliche Verein Langenbrettach e.V. einem
alten Brettacher Geheimnis auf den Grund zu gehen. Vorstand und Ausschuß
waren sich darin einig zu untersuchen, ob denn tatsächlich ein unterirdischer
Gangvom Chanofsky-Schlößle zum Kirchbrunnen führte. Hat
Junker Heinrich Chanofsky von Langendorf, Folstmeister zu Neuenstadt, im
Jahre 1594 mit dem Bau des Renaissance-Schlößchens einen Fluchtweg
graben und einwölben lassen? Diese Frage sollte geklärt werden.
Dabei schwang etwas von kindlicher Abenteuerromantik mit. Der Grund? -
Alle Brettacher Kinder haben am Brünnle früher schon Wasser getrunken,
im Kirchbrunnengewölbe Abenteuer gespielt, z.B. indem sie den Abfluß
verstopften,dadurch den Gewölbeboden einige zehn Zentimeter mit Wasser
füllten, um dann mit einem selbstgebastelten Floß in See zu
stechen. Die Abreibung zu Hause ließ dann für die durchnäßten
und verdreckten Höhlenschiffer nicht lange auf sich warten. Vor allem
der schmale dunkle Seitengang, der senkrecht vom Hauptgewölbe in Richtung
Dorf weist, hat die Fantasie der Brettacher Dorfjugend und der Erwachsenen
seit Generationen immer wieder beflügelt: War das der unterirdische
Gang zum Schlößle? Die Marschroute des Vereins war klar vorgezeichnet:
Licht in das Dunkel bringen, die Eingänge freilegen und - wenn nötig
- restaurieren.
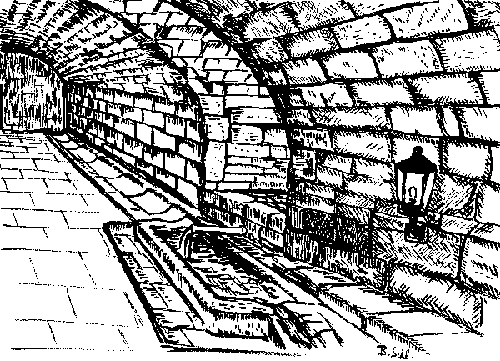
Eine
erste Besichtigung zusammen mit BM Schaaf war ernüchternd für
uns. Die Gewölbeeingänge waren seit den 60er Jahren zugeschüttet,
der Vorplatz eingeebnet und mit Büschen bepflanzt. Zu beiden Seiten
versperrten je zwei dicke Luftschutzmauern den Uberblick, Erinnerungsstücke
an das tausendjährige Reich. Durch eine schmale Einstiegsluke - manche
etwas Leibesumfänglichere zwängten sich mühevoll durch -
erreichte die Gruppe den total verschlammten Gewölbekeller. Im Schein
der Feuerwehrlampe bot sich ein trostloses Bild. Die Quelle war unter einer
0,5 m dicken Dreck-, Schutt - und Schlammschicht verschüttet, der
Seitengang bis zur halben Höhe mit Bauschutt gefüllt, und ein
Teil des nördlichen Sandsteingewölbes war wegen des Kreisverkehrs
rund um die Linde abgerissen und verschoben. Zu allem Übel stellte
sich einige Zeit später dann heraus, daß der Gewölberaum
seit der Ortskanalisation in den 60er Jahren sozusagen als Sickerraum diente.Von
der Backhausseite her wurden die Oberflächenwässer in das Gewölbe
eingeleitet, ohne sie auf der Gegenseite in die Kanalisation abzuleiten.
Schon von da her, ohne Berücksichtigung des historischen Werts, war
eine Sanierung dringend geboten. Die schweren Fahrzeuge, die am Lindenplatz
wendeten, hätten in nicht allzu langer Zeit das völlig durchfeuchtete
Gewölbe zum Einsturz gebracht. Niemand wußte bis zu diesem Zeitpunkt,
daß der Kirchbrunnen als Sickergrube benutzt wurde. Trotz der Schwierigkeiten
beschlossen Gemeinde und Verein diese einmalige historische Stätte
in gemeinsamer Arbeit freizulegen und zu restaurieren und damit der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand sagen, ob
die Quelle wieder zu finden war.
Nach einem Lokaltermin war das Landesdenkmalamt
bereit, die Hälfte der veranschlagten Kosten von DM 37.000,- zu übernehmen.
Im Frühjahr 1986 baggerten
Gemeindearbeiter die beiden Eingänge frei. Anschließend entfernte
man drei der vier Luftschutzmauern, eine auf der Nordseite mußte
auf Grund einer statischen Untersuchung als Stütze für das beschädigte
Gewölbe stehenbleiben. Vereinsfreiwillige und Gemeindearbeiter ergänzten
sich gegenseitig. Insgesamt wurden ca 15 Lastwagen Schutt und Schlamm abgefahren.
Ein großer Teil davon mußte mit Pickel, Spaten und Schaufel
ergraben und aus dem Gewölberaum ins Freie gekarrt werden. Der Heimatgeschichtliche
Verein erbrachte seit 1986 ca 1200 freiwillige Arbeitsstunden; auch Nichtmitglieder
aus der Gemeinde halfen zeitweise mit. Nach anfänglicher Skepsis von
Seiten der Bevölkerung - es gab auch Brettacher, die meinten, man
solle doch den 17 Meter langen und 5 Meter breiten Raum einfach zuschütten
- überwog mit dem Bautortschritt die Zustimmung.
Neben den vielen "kleinen" Arbeiten,
vom Vermessen des Geländes und dem Erstellen von Zeichnungen bis hin
zum Streichen der Geländer, haben uns vor allem die schweißtreibenden
Schindereien und die vielen unvorhergesehenen Arbeiten und die Verzögerungen
fast resignieren lassen. Eine Reihe von handwerklichen Fertigkeiten des
Hoch- und Tiefbaus waren gefordert. Es mußten z.B. Fundamente unterfangen,
die Kanalisation gegraben, Mauern ausgebessert, Tore und Türen gefertigt,
Sandsteinplatten verlegt und elektrische Anschlüsse geschaffen werden.
Die anstrengendste und schwierigste Arbeit war die Neufassung der Kirchbrunnenquelle.
Auf engstem Raum knietief im Wasser und im Schlamm arbeitend, mußten
der alte Quellfassungstrog und Sandsteine entfernt und die wasserführende
Schicht gesucht werden, ohne daß sich das Wasser, falls wiedergefunden,
einen neuen Weg suchte. Als unsere Bemühungen erfolgreich waren und
das Quellwasser wieder in den steinsargähnlichen Sandsteintrog lief,
der bei der Ausgrabung vor dem Quellengang zutage kam, war der Jubel groß.
Wenn es für uns Hobbyrestauratoren allzu schwierig wurde, mußten
die Handwerker des Dorfes ran, wie z.B. bei der Errichtung der Stützmauer
gegen die Straße und bei den Steinmetzarbeiten. Als schließlich
nach zweijähriger Bauzeit unser Projekt "Kirchbrunnen" fast abgeschlossen
war, beschlossen Gemeinde und Verein in einer Einweihungsfeier der Bevölkerung
unsere Ergebnisse zu zeigen.
Ubrigens, bei aller Freude darüber,
daß die Quelle wieder sprudelt, eine Ernüchterung brachte unsere
Aktion doch: Einen unterirdischen Gang vom Schlößle zum Kirchbrunnen
hat es nie gegeben. Der kleine überwölbte Seitengang über
der Quellfassuns hat die romantische Fantasie der Brettacher zu sehr ins
Kraut schießen lassen. Keinerlei Indizien deuten darauf hin, daß
es nach dem abgemauerten Ende des Seitenganges weiterging.
Geschichte und Bauzeit
Die am häufigsten
gestellte Frage ist die nach dem Alter des Kirchbrunnens. Leider
erfährt man aus dem Gemeinde- und Pfarrarchiv direkt nicht sehr
viel. Unter der Überschrift "Der Kirchbronnen und das Gewölbe"
beschreibt der Chronist Franz Häfelin 1858 den Kirchbrunnen so:
"Ein Theil des Lindenplazes ist überwölbt; unter diesem Gewölba
fließt der sogenannte Kirchbronnen. Die Zeit der Überwölbung
des fraglichen Plazes, ist bis jezt noch unbekannt. In der Beschreibung
des Oberamts Neckarsulm von 1881 steht "Gerade vor dem Eingang zum
Kirchhof liegt ein großes Gewölbe, in welchem der für
heilkräftig geltende Kirchbronnen quillt". Im folgenden wird
versucht, eine Beweiskette für die Bauzeit aufzustellen. Dazu
ist es nötig, verschiedene historische Quellen zu bemühen.
Neben den Aufzeichnungen des Franz Häfelin liefert uns vor allem
Pfarrer Artur Klein wichtiges Material. Er verfaßte aus Unterlagen
der Kirchenbücher und aus dem Rathausarchiv 1955 während
der Kirchenrenovierung eine Schrift mit dem Titel "Geschichte der
Brettacher Kirche". Die Untersuchungen von Franz Häfelin und
die von Pfarrer Klein ergeben letztendlich zusammen ein klares Bild
über das Alter unseres Kirchbrunnens. Franz Häfelin kam
um 1800 als Ratsschreiber nach Brettach,verheiratete sich hier, wohnte
im Chanofsky-Schlößchen und übte seine Amtstätigkeit
später auch in Cleversulzbach und Neuenstadt aus. In den 20er
Jahren des vorigen Jahrhunderts war er einige Zeit Schultheiß in
Brettach. Wenn wir davon ausgehen, daß früher bei mündlichen
Uberlieferungen die Erinnerungen zwei bis drei Generationen zurückreichten,
dann muß das Kirchbrunnengewölbe auf jeden Fall vor 1680
gebaut worden sein. Baustilvergleiche mit den Kellern im Lindenhof und
im Schlößle weisen in dieselbe Richtung.
Eine genauere Datierungsmöglichkeit
ergibt sich aus den Aufzeicrhnungen von Pfarrer Klein. Er stellt folgende
geschichtliche Betrachtungen an den Beginn seiner Ausführungen: Brettach
ist eine um 500 n.Chr. entstandene alamannische Tochtersiedlung von Odoldinga,
einer in der Gegend des heutigen "Gelben Felsens" gelegenen Ansiedlung.
Und wörtlich heißt es weiter: "Brettach nahm sehr wahrscheinlich
seinen Ausgang von einem Hof bei der heutigen Linde." "Der dazu gehörige
Brunnen ist der Lindenbrunnen gewesen". "Es spricht viel dafür, daß
der Lindenbrunnen ein alamannisches Quellenheiligtum war. An die Stelle
dieses Heiligtums trat zu fränkischer Zeit eine christliche Kapelle".
Vermutlich war diese erste christliche Kirche aus Holz gebaut. Erwähnenswert
ist in diesem Zusammenhang, daß in das Kirchbrunnengewölbe noch
vor einigen Jahrzehnten zwei Quellen flossen, die jetzt neu gefaßte
und eine weitere nahe dem nördlichen Gewölbeausgang. Sie floß
in einem Rohr vom Lindenhof herüber. Das Loch in der Sandsteinmauer
und die Abflußrinne im Gewölbe sind noch erhalten. "Gegen Ende
des 10.Jahrhunderts", schreibt Pfarrer Klein weiter, "wurde durch die Grundherrschaft
auch in Brettach eine Kirche erbaut, und zwar gegenüber dem Herrenhof
- so war es die Regel - ,auf dem aus dem Tal ansteigenden Gelände,
also an der Stelle des oben erwähnten heidnischen Quellenheiligtums".
Und weiter unten heißt es: "Viele Kirchen wurden zum Schutz der Bevölkerung
als Wehrkirchen angelegt". Der Wehrfriedhof hatte eine 0,9 Meter dicke
Mauer, "die ein 8 bis 10 Meter breiter Graben umgab". Aus den Unterlagen
des Pfarrarchivs geht hervor, daß um die Wehrkirche mit dem 32 Meter
hohen bergfriedähnlichen Turm 23 Gaden von innen an die Kirchhofmauer
angebaut waren. Sie dienten als Fruchtlagerhäuschen und hatten kleine
gewölbte Keller. Der mächtige Turm mit den Gaden ringsum und
der Graben, der im nördlichen Bereich in den Dorfweiher mündete,
verstärkten den burgähnlichen Gesamtcharakter. 1573 wurde auf
Betreiben der Gadenbesitzer der Friedhof nach Westen erweitert. Die Einwohnerzahl
von Brettach war gewachsen. Aus diesem Grund beantragte der Pfarrer "Kirch
und Vorhof" erweitern zu dürfen, die "Kirchgedamen abzureißen"
und "die Mauer der Kirche zu verrücken". Die Kirche war zu klein geworden.
Die zu dicht an der Kirche stehenden Gaden waren einer Erweiterung im Wege.
Sie hatten zwar längst ihre Schutzfunktion eingebüßt, aber
die Besitzer wollten ihre kleinen Lagerhäuschen nicht aufgeben. Erst
als ihnen in Aussicht gestellt wurde, in der neu zu bauenden Kelter Raum
zu bekommen, verzichteten sie darauf. Am 10.7.1578 wurde dann die alte
Kirche abgebrochen. Man darf annehmen, daß der Bauschutt der Gaden
und der Kirche dazu verwendet wurde, den alten Wehrgraben aufzufüllen.Eine
dendrochronologische Untersuchung (Altersbestimmung des Holzes) eines Eichenbalkens,
der unter dem Fundament des Kirchbrunnengewölbes lag, könnte
interessante Aufschlüsse bringen.
Fassen wir zusammen:
Erstens, die
"heilige Quelle", die aus heidnischer Zeit übernommen und christianisiert
worden war, sprudelte am Grabenrand der Wehrkirche, also außerhalb
der Mauer.
Zweitens, der Eingang zur alten
Wehrkirche führte von der Mühlstraße her über eine
hohe Treppe an die Südwestecke der alten Kirchhofmauer.
Drittens, erst um die Zeit als Gaden
und Friedhofsmauern versetzt warden waren, wurde der heutige Zugang zur
Kirche von der dann so benannten Kirchstraße her geschaffen. Dazu
schreibt Pfarrer Klein: "Leider ist nicht mehr festzustellen, wann der
heutige Eingang angebracht wurde.1578 bestand er auf jeden Fall schon".
Aus diesen drei Punkten können folgende Schlüsse gezogen werden:
Die Brettacher wollten mit (nach) der Kirchenerweiterung einen ebenerdigen
Zugang zu ihrer Kirche, um nicht mehr die beschwerlichen Stufen von der
Mühstraße her erklettern zu müssen. Man befand sich aber
in einem Zielkonflikt. Durch bloßes Einebnen des östlichen Wehrgrabens
hätte man die als heilkräftig geltende Quelle mit zuschütten
müssen. Man kann sich gut vorstellen, daß den Brettachern ihr
als heilkräftig geltendes Wasser so viel wert war, um ein Gewölbe
darüber zu bauen. Sie hatten damit einen breiten ebenen Zugang zur
Kirche und ihre Quelle blieb unversehrt. Vielleicht fällt es manchem
etwas schwer, sich die Wertmaßstäbe unserer Vorfahren vorzustellen.
Sie haben dem Grundnahrungsmittel und Lebenselixier Wasser viel größere
Bedeutung zugemessen als wir heute. Wir dürfen also durchaus fest
annehmen, daß 1578 das Kirchbrunnengewölbe bereits bestand,
daß es kurze Zeit zuvor gebaut wurde.
Die Pflanzdaten der Brettacher Linde
führen als eine Art zweite Beweiskette zu einem ähnlichen Resultat.
Franz Häfelin hat das Alter der verschiedenen Linden zurückverfolgt.
Außerdem steht auf einer der beiden Gedenktafeln der Lindenumfassung
folgendes: "1566 ward dise Linden gesezt". Aber niemand würde eine
Dorflinde an den Abhang eines Wehrgrabens setzen. Daraus kann geschlossen
werden, daß die erste Linde an dieser Stelle auf einen ebenen freien
Platz gepflanzt wurde.Das heißt aber: die Bauzeit für den neuen
Kirchenzugang und die für das Kirchbrunnengewölbe wären
um 1566 anzunehmen. Der heutige Kirchhofeingang und das schmiedeeiserne
Tor wurden 1844 geschaffen. Diese Jahreszahl ist in die beiden Toreinfassungen
eingemeißelt. Die gesamte Neugestaltung von 1844 ist in der Häfelinschen
Chronik beschrieben. Auf den südlichen Gewölbeeingang wurde eine
schwere Sandsteinmauer gesetzt, nachdem man das Gewölbe noch einmal
um ca. 2 Meter erweiterte. Die "Heilige Quelle" begleitet uns durch die
ganze Brettacher Geschichte. Das schützend über die Quelle errichtete
Gewolbe hat uns einen Teil des Grabens der ehemaligen Wehrkirche erhalten.
Der Raum diente im Laufe der Jahrhunderte unter anderem als Remise für
landwirtschaftliche Geräte. Er war zuletzt im Zweiten Weltkrieg Luftschutzraum.
Im April 1945 fanden viele Anlieger Schutz vor Artilleriegranaten und Brandbomben.
Dieses zwar einfache aber für uns Brettacher geschichtlich wertvolle
dorfliche Kulturdenkmal ist es wert erhalten zu werden. Gewölbe, Quelle
und Fundamente sind jetzt trocken, gesichert und - was wichtig ist - der
Bevölkerung nahegebracht.
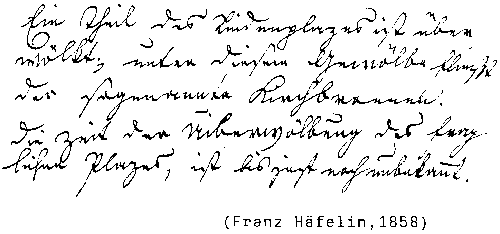
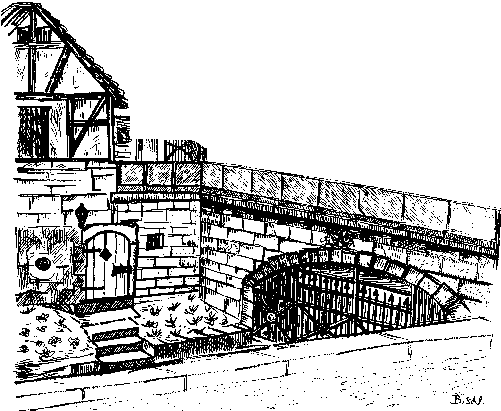
GADEN
Ein Gaden ist ein Haus (Häuschen) mit nur einem Zimmer. Dessen Bewohner nannte man Häusler. Aber Gaden sind auch Häuschen innerhalb oder auf der Mauer einer Wehrkirche. Das links neben dem Kirchhofeingang erhaltene "Häuslin" mit seinem kleinen Gewölbekeller ist beispielhaft für einen Gaden. Ob dieses Häusle allerdings einer der ursprünglich 23 Wehrkirchengaden ist, darf in Frage gestellt werden. Der Verlauf der Wehrmauer ist an dieser Stelle nicht mehr genau auszumachen. Der Kellereingang müßte auf jeden Fall innerhalb der Mauer und nicht im Wehrgraben liegen. Trotzdem bietet dieses Häuschen ein Bild, wie man sich etwa die 23 Gaden vor 1578 vorzustellen hat. Franz Häfelin schreibt 1858 zu dem Fachwerkhäuschen: "Das an die Kirchhof Mauer angebaute - und zu ebener Erde mit einem kleinen Gewölbe, /so früher als Gefängnis benutzt worden/ versehene sogenannte Armenhäußchen im Brand Cataster mit No. 147 bezeichnet, ist Eigenthum der Gemeinde, wird zur Zeit von Orts Armen bewohnt, und war in früheren Zeiten den Nachtwächtern zum Aufenthalt angewiesen". Dieser Gaden war eines von drei Armenhäusern der Gemeinde. Eigentlich müßte man wegen der früheren vielfältigen, typisch dörflichen Nutzung das kleine Häuschen unter Denkmalschutz stellen. Anzumerken ist, daß es nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 50er Jahre von einem Ehepaar bewohnt war. Die Wohnungsnot im zerstörten Brettach war sehr groß.
PESTTOR
Im Neckarsulmer
Heimatbuch von 1928 schreibt Friedrich Krapf "1636 wüteten" in Brettach
"Hungersnot und Pest. Damals erhielt das 1613 neu erstellte Tor des Friedhofs
den Namen Pesttor". Und weiter heißt es: "Vor dem neuen Kirchhoftor
- das alte sogenannte Pesttor aus dem Jahr 1613 ist jetzt zugemauert -
steht über einer alten heilkräftigen Quelle dem Kirchbrunnen,
eine mit Säulen gestützte Linde". Der Name Pesttor stammt von
1636, als während des 30-jährigen Kriegs in Brettach die Seuche,
von Soldaten eingeschleppt, wütete und die Toten unmittelbar hinter
dem Tor in Massengräbern beigesetzt wurden. In den Kirchenbüchern
von 1613 im Bereich der Buchführung sind zu Kirchhofmauer und Tor
unter anderem folgende Eintragungen nachzulesen: "...ist das Theil Kirchmauren
gegen Bernhardt Sützlers garten Abzubrechen, den Kirchhof zuerweitern
mit einer neuen Mauren wieder uffzuführen. 300 Schuh lang und 14 Schuh
hoch, sambt ganzer Kirchhofmauren zubestechen und zu weißen...".
"Item von einem einfart Thor zu solche Kirchmauren, mit ausgehauenen Stückhen
zumachen."
In den letzten Jahren drohten Kirchhofmauer
und Tor einzustürzen. In die Abdeckung drang Wasser, der Frost tat
ein übriges. Vor der Mauer standen kleinere landwirtschaftliche Gebäude.
Sie wurden abgerissen, und den davor liegenden Grund kaufte die Gemeinde.
Da Land und Kreis Zuschüsse gewährten, fiel es der Gemeinde leicht,
das Tor in ursprünglicher Art und die Mauer mit den alten Steinen
wieder aufzubauen. Leider war das alte Tor so stark beschädigt, daß
es neu gefertigt werden mußte. Und leider ließ sich die Inschrift
links und rechts von der Jahreszahl nicht mehr entziffern.
In die wieder aufgebaute Mauer wurde
das Epitaph des württembergischen Amtmanns von Olnhausen gesetzt.
Der Sandstein war schon stark angegriffen. Er wurde in Tauchbädern
verfestigt, und es wurde die Inschrift nachgezogen und ergänzt. An
der neuen Stelle steht das schöne Rokoko-Epitaph geschützt. An
der südlichen Kirchhofmauer war es zu sehr dem Wetter und dem Tropfwasser
von den Bäumen ausgesetzt.

aus "Rückblicke" des Heimatgeschichtlichen
Vereins Langenbrettach e.V. [Nr.46-51]
Verfasser: Herbert Schlegel
Zeichnungen: Barbara Schlegel