Strom vom Flusskraftwerk Endreß in Gochsen
Die Angst vor dem Computercrash zur Jahrtausendwende ist schon beinahe
wieder vergessen. Was hat man nicht alles für Horrorszenarien an die
Wand gemalt. Stromausfall - eine Katastrophe für alle Industrieländer.
Von Flugzeugabsturzen und von schwerer Wirtschaftskrise war die Rede. Kerzenlicht
als Notbeleuchtung zum Jahreswechsel
einerseits romantisch, andererseits eines modernen Menschen unwürdig.
Elektrische Energie ist halt aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken.
Dabei ist es erst knapp hundert Jahre her, daß Brettach an die
Elektrizität angeschlossen werden konnte. Das war eigentlich sehr
früh. Konnten doch viele kleine Gemeinden im Königreich Württemberg
sogar erst nach dem I.Weltkrieg und in den 20er Jahren mit Strom versorgt
werden.
Um 1900 wußte niemand, ob es sich lohnen würde, an kleinen
Flüssen, wie z.B. am Kocher in Gochsen, ein E-Werk zu errichten und
zu betreiben und ein Stromnetz aufzubauen.
Um so mehr ist der Wagemut und der Pioniergeist des Leonhard Endreß
aus Gochsen zu bewundern, der beschloss, die Wasserkraft seiner Kochermühle
nicht mehr zum Getreidemahlen zu nutzen, sondern sie in die neue Energieform
Elektrizität umzuwandeln. Damit bestand für die umliegenden Gemeinden
die Chance, Licht und Kraft aus dem Kochertal zu erhalten. (Neuenstadt
hatte zu dieser Zeit bereits eigenes Stadtgas).
Erste Verhandlungen in Brettach über den Anschluss an das zu bauende
Flusskraftwerk und über die Installation eines regionalen Stromnetzes
fanden bereits 1901 statt. Die Verhandlungspartner sind einerseits die
"Mitteldeutsche Elektrizitätswerke, Aktiengesellschaft in Dresden"
(Abkürzung: M.E.A.) und Leonhard Endreß in Gochsen und andererseits
die Gemeinde Brettach. Mit der M.E.A. zusammen will Endreß das Flusskraftwerk
bauen. Am 5. März 1901 unterzeichnen die Gemeinderäte, der Bürgerausschuss
und der Bürgermeister von Brettach den Vertrag.
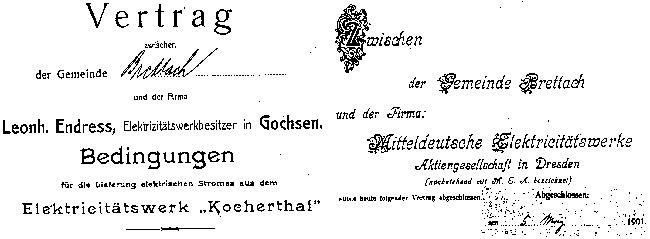
Die M.E.A. wollte 1901, nach einer behördlichen Genehmigung, nach
längstens 7 Monaten mit der Ausführung der erforderlichen baulichen
Maßnahmen beginnen. Dass sich die Elektrifizierung von Brettach noch
5 Jahre hinzog, lag z.T. daran, dass sich der Bau des E-Werks in Gochsen
verzögerte. Probleme bei der Uberleitung und rechtliche und organisatorische
Schwierigkeiten traten auf.
Die Zukunft beginnt
Die Brettacher Bürger hatten also von 1901 bis 1906 Zeit, sich
mit der Neuerung auseinanderzusetzen. Einerseits herrschten gespannte
Erwartung und Fortschrittsglaube, andererseits gab es auch Skeptiker:
Ist diese revolutionäre Energieversorgung vielleicht nicht doch
schädlich? Wie reagieren Mensch und Vieh auf Glühbirne und Elektromotor?
Schädigen die Leitungen über meinem Acker die Feldfrüchte ?
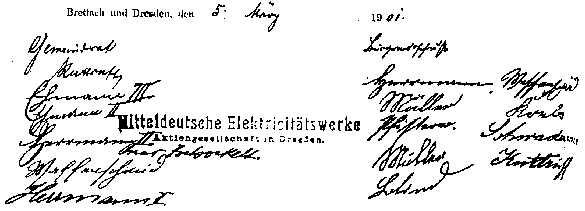
Soll ich, falls erforderlich, der Aufstellung eines Strommastes auf
meinem Acker zustimmen? Welche Entschädigung gibt es dafür?
Solche und ähnliche Fragen wurden in der Familie, am Milchhäusle,
in den Gasthäusern und bei den sogenannten "Werkstattgesprächen",
den Umschlagplätzen für Neuigkeiten und Diskussionen, erörtert.
A propos "Werkstattgespräche": Im Winter wärmten sich die älteren
Bauern in den Werkstätten der Handwerker auf. Grüppchenweise
zogen sie oft, fast nach einem festgelegten Plan, von einer Werkstatt zur
anderen. Auch bei der "Vorsitz" im Winter, wo man Verwandte und Nachbarn
zu Gast hatte und bei althergebrachter Beleuchtung arn Spinnrad oder Webstuhl
saß, Textilien und Geräte flickte, auch das Essen und Trinken
und das Singen nicht vergaß, Schauergeschichten erzählte und
Paare verkuppelte, wurde über Vor- und Nachteile der neuen Technik
diskutiert. Die Zeitungen versuchten zu erläutern, welche Folgen ein
Stromstoß für Mensch und Tier haben kanri und daß ein
Kurzschluß Brandgefahr für Haus und Hof bedeutet. Manchem weitgereisten
Wichtigtuer hörte man gespannt zu, wenn er seine "Erfahrungen", die
er in den bereits elektrifizierten Städten erworben hatte, zum besten
gab.
Für Beleuchtung vor der elektrischen Glühbirne waren entweder
rußende und stinkende Ollampen gebräuchlich, betrieben mit Leinsamen-
oder Rapsöl (Rüböl) oder Stearinkerzen aus Talg und Unschlitt
(im Dialekt, "Inschtlich" = Rinderfett) oder die besseren Paraffinkerzen.
Licht in Haus und Stall lieferten auch die unzähligen patentierten
Petroleumlarnpen mit Docht und eingebautem Vorratsbehälter fürs
Petroleum. Die erste Petroleumlampe verbreitete ab 1855 in den USA ihr
relativ helles aber rußendes Licht. Das dünnflüssige energiereiche
Petroleum gab es etwas später auch bei uns in allen Kolonialwarenläden
zu kaufen. Der nachschiebbare brennende Docht lieferte ein für darnalige
Verhältnisse brauchbares Licht. Während der Kriege im 20. Jahrhundert
und in der Notzeit nach 1945 taten die Petroleumlampen bei den häufigen
Stromausfällen immer noch gute Dienste. Die ersten Stearin- und Paraffinkerzen
gab es ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Die kostbaren und teuren Kerzen
aus Bienenwachs wurden meist nur an Festtagen, wie z.B. an Weihnachten,
angezündet.
Es gab auch so arme Familien, die sich von alledem nichts leisten konnten;
manche noch nicht einmal Streichhölzer. Man schlug Funken mit dem
Feuerstein und beleuchtete noch wie zu ganz alten Zeiten das Haus mit dem
Kienspan, der am Ofen angezündet wurde.
Vom Gaslicht zur Glühbirne
Die sogenannten besseren Leute, die Reichen in den Städten, konnten
sich ab etwa 1860 in Deutschland (in England einige Jahrzehnte früher)
Gasbeleuchtung einrichten lassen. Zunächst in Fabrikhallen und in
der Straßenbeleuchtung eingesetzt, wurden dann Hotels, Gaststätten,
Säle und schließlich auch Wohnhäuser mit Gaslicht ausgestattet.
Die Gaslampe beleuchtete noch lange, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein,
die Straßen in den Städten. Wegen des hohen Sauerstoffverbrauchs
und der Explosionsgefahr verdrängte die elektrische Glühbirne
sehr rasch in geschlossenen Räumen die Gaslampe. Karbidlampen, mit
Azetylen betrieben, spielten nur im Industrie- und Fahrzeugbereich eine
Rolle.
Der Elektrizität gelang innerhalb weniger Jahrzehnte der Durchbruch.
Erste wissenschaftliche Versuche mit der Elektrizität gehen bis ins
16. und 17. Jahrhundert zurück. 1663 entwickelte Otto von Guericke
eine Elektrisiermaschine und experimentierte damit. In der Folgezeit haben
eine große Zahl von Forschem die Geheimnisse um die Elektrizität
gelüftet. Jeder Schüler kennt heute die Forschernamen Galvani,
Volta, Ohm, Faraday, Morse - um nur einige zu nennen - aus der Elektrizitätslehre
als Bezeichnung für elektrische Einheiten.
Thomas Alva Edison brachte 1879 auf der Basis von Experimenten der
Forscher und Erfinder vor ihm Pflanzenfasern im Vakuum durch elektrischen
Strom zum Glühen. Damit war eine einigermaßen funktionstüchtige
Glühbirne geschaffen. 1906 karn Osrams Glühbirne mit Wolframfaden
auf Grund eines Wettbewerbs auf den Markt.
Wichtig für die Energieübertragung war die Entwicklung einer
praxistauglichen Dynamomaschine durch Wemer von Siemens im Jahr 1867. Emil
Rathenau baute 1884 das erste öffentliche Elektrizitätswerk.
Die Industrie nutzte zuerst die neue Energie. Die ersten Dynamomaschinen
wurden durch Dampfmaschinen, Motoren oder durch Wasserkraft angetrieben.
Eine rentable Energieübertragung über lange Strecken war erst
ab 1891 möglich. Während der Frankfurter Elektrotechnischen Ausstellung
1891 wurde erstmals Drehstrom von Lauffen am Neckar nach dem 175 Kilometer
entfernten Frankfurt am Main mit hohem Wirkungsgrad mit einer Spannung
von 20 000 Volt übertragen.
Auch in der Anlage von Leonhard Endreß in Gochsen arbeitete eine
moderne Drehstrommaschine, gebaut von der Maschinenfabrik Eßlingen.
Der Streit, ob Gleichstrom (wie z.B. in Öhringen) oder Drehstrom ging
noch eine Zeitlang zwischen den Anbietern und den Fachleuten weiter. Bis
1913 sind die Diskussionen auch in unserem Raum belegbar. Schließlich
ebbten die Auseinandersetzungen ab. Die Vorteile lagen eindeutig auf Seiten
des Drehstroms, der, wenn er hochgespannt ist, beim Transport wenig abfällt
und deshalb kostengünstiger als Gleichstrom über große
Entfernungen transportiert werden kann. Außerdem treten z.B. beim
Betrieb von Motoren und Elektroherden weniger Probleme auf.
Die Hersteller elektrotechnischer Anlagen, die Kundengruppen und die
kommunalen Körperschaften brauchten in unserer Region mehr als ein
Jahrzehnt, um sich zusammenzuraufen. Vor allem um die Führung der
Starkstromleitung wurde heftig gerungen. Auf Druck von Stuuttgart haben
sich die Oberämter Neckarsulm, Weinsberg und Öhringen geeinigt.
Der elektrische Strom aus der Ausnützung der Wasserkraft des Neckars
sollte ausschließlich der Eisenbahn dienen.
Immer wieder wurden neue Rentabilitätsberechnungen angestellt.
Vor allem in den Bereichen flächendeckende Leitungsführung und
Starkstrom.
Ähnlich wie heute bei der Computerisierung waren um 1900 große
Unternehmen und kleine Handwerker erfrig dabei, beim Aufbau der neuen Technologie
mitzurnischen, d.h. mitzuverdienen. Elektrotechnische Betriebe jeglicher
Art drängten mit mehr oder weniger sinnvollen Erfindungen auf den
Markt.
Der Vertrag
In § 1 des Vertrags zwischen der Gemeinde Brettach und der M.E.A.
heißt es:
"Die vorerwähnte Gemeinde erteilt hiermit der M.E.A. für
das von ihr zu erbauende Elektricitätswerk 'Kocherthal' ausschließlich
das Recht zur ober- oder unterirdischen Führung von Elektricitätsleitungen
auf allen Straßen, Plätzen, Brücken und dergleichen im
derzeitigen und zukünftigen Gemeindegebiete und zur Lieferung von
elektrischer Energie zu Beleuchtungs- und sonstigen Zwecken an Private
und Behörden sowie an die Gemeinde zum Zwecke der Straßenbeleuchtung
(hinsichtlich welcher die Zahl der Glühlampen und etwaigen Bogenlumpen
noch festzusetzen ist) auf die Dauer von fünfzig. Jahren (.. !!! ...)
vom Tage der Inbetriebsetzung an gerechnet mit der ausdrücklichen
Verpflichtung während der Vertragsdauer ein anderes Unternehmen für
Beleuchtung oder Kraftübertragung nicht zu konzessionieren noch selbst
zu betreiben ".
Um die Änderung des letztgenannten Vertragspassus wurde bald heftig
gestritten, wollten doch einige Jahre vor dem I. Weltkrieg die Gemeinden
auch anderen Gesellschaften die Überleitung über Gemeindegebiet
gestatten. Starkstromleitungen durften schließlich Über das
Gemeindegebiet geführt werden.
Dass der Vertrag auf 50 Jahre abgeschlossen wurde, spricht für
den unbändigen Optimismus der Partner, nicht ahnend was die erste
Hälfte des 20. Jahrhunderts für Kriege und
Wirtschaftskrisen bringen würde, nach denen Verträge erneuert
werden mußten.
Dass die Grundstuckseigentümer eventuell Schwierigkeiten machen
könnten, dessen war man sich offensichtlich bewußt. Den schwarzen
Peter dabei hatte der Gemeinderat. Im Vertrag heißt es:
" Soweit ein Eigentum Dritter in Frage kommt, deren Zustimmung nicht
ohne Weiteres erlangt werden sollte, wird der Gemeinderat seinen Einfluß
zur Erreichung derselben nach Möglichkeit geltend machen. Bis zur
Beseitigung des Hindernisses ist das Werk berechtigt, die Stromabgabe für
die betreffende Straße zu unterlassen.''
Tatsächlich sollen sich, laut mündlicher Uberlieferung, die
Anwohner einer engen Gasse in Brettach zunächst geweigert haben,
Masten aufstellen zu lassen. Man fürchtete für Heu- und Erntewagen
nicht genügend Platz zu haben. Des weiteren heißt es im Vertrag:
"Der Stromabnehmer gestattet ausdrücklich, an seinem Haus die
erforderlichen Dach- oder Wandgestänge, Isolatoren und Leitungen kostenlos
anbringen zu lassen, bzw. auf seinem Grundstücke die Aufstellung der
nötigen Masten, Streben, Anker und die Führung der Leitung kostenlos
zu erlauben. "
Das hieß: Das Dorfbild verändert sich. In einigen Häusern
soll es Schwierigkeiten gegeben haben, weil die Monteure z:B. keine feste
Verankerung im Dachstuhl fanden.
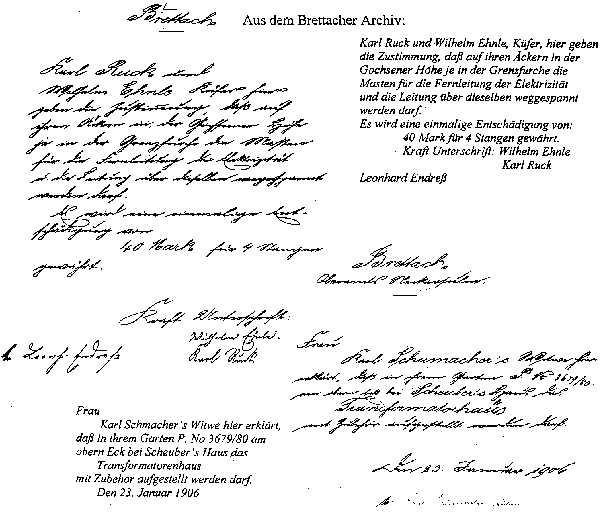
Das E-Werk liefert alles:
"Das Verlegen sämmtlicher Leitungen nebst Zubehörteilen innerhalb
des Grundstückes, die Lieferung und Aufstellung der Glühlampen,
Bogenlampen, Apparate, Motoren, Maschinen und dergl. sowie die an den Einrichtungen
etwa notwendig werdenden Änderungen, Erweiterungen und Lieferung der
jeweiligen Ersatzstücke und des Betriebsmaterials (Glühlampen,
Kohlenstifte, Motorbürsten) erfolgen ausschließlich durch das
Elektrizitätswerk auf Antrag und für Rechnung der Abnehmer. ...
Maurer-, Schlosser-, Maler-, Tischler-, oder Zimmererarbeiten sind von
der Lieferung des Elektricitätswerkes ausgeschlossen. "
Laut Vertrag waren alle ans Netz angeschlossene Stromkunden verpflichtet,
alles Zubehör und Gerät, sogar die Glühlampen, im E-Werk
zu kaufen. Diese Verpflichtung und die strenge Vorschrift, dass aus naheliegenden
Gründen nur vom E-Werk lizensierte und ausgebildete Monteure (Elektriker
war ein neuer Beruf!) das Netz aufbauen und reparieren durften, führte
nach kurzer Zeit zu Schwierigkeiten. Die "Tüftele" (heute würde
man von Hobby- oder Heimwerkern sprechen) reparierten oder installierten
für wenig Geld oder aus Nachbarschaftshilfe die Einrichtungen ohne
Entgelt. Kam das E-Werk dahinter, wurde mit dem Gericht gedroht.
Die Kosten
Der Preis für die Lieferung elektrischen Strom s für Beleuchtungszwecke
betrug 6 Pfg. pro Hektowattstunde (1 Hektowatt = 100 Watt; 1 Kilowatt =
1000 Watt). Hiernach kostete jede Brennstunde
einer l0kerzigen Glühlampe = 30 Watt 1,80 Pfg.
einer 32kerzigen Glühlampe = 100 Watt 6,00 Pfg.
Für die damaligen Verdienstverhältnisse ein hoher Preis.
Viele einfache Landbewohner konnten sich nur 15 Watt oder 30 Watt Glühbirnen
leisten. Der gewerbliche Strom kostete 2,5 Pfg. pro Hektowattstunde. Im
Jahr 1906 erhielt ein Waldarbeiter als Taglöhner ca. 12 Reichsmark
Wochenlohn. Bei einer Brenndauer im Winter von 28 Wochenstunden war für
eine 30 Watt Glühbirne 50 Pfennig für den reinen Strompreis zu
bezahlen, andere Kosten nicht eingerechnet. Kleinere Anlagen, z.B. Haushalte,
wurden gegen Pauschalsummen angeschlossen. Der Verbrauch wurde anhand einer
Tabelle ermittelt.
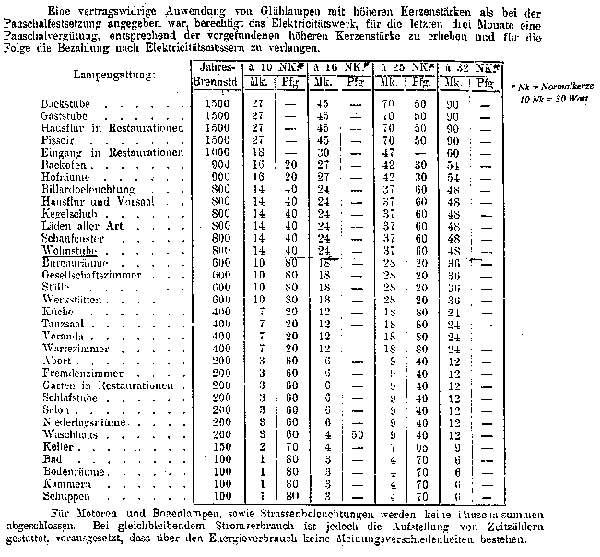
Die Leistung der Glühbirnen und Elektrogeräte und die Anzahl
der Brennstellen wurde monatlich von einem Kontrolleur überprüft. Eine vertragswidrige Anwendung von Glühlampen mit höheren
Wattstärken berechtigte das E-Werk entweder rückwirkend eine
höhere Pauschale zu verlangen oder einen Zähler zu setzen, dessen
Einrichtung Miete kostete. Wer nicht bezahlte, dem Beamten des E-Werks
den Zutritt verweigerte, die Plomben am Zähler entfernte oder bei
Pauschalzahlung stärkere Verbraucher einsetzte als erlaubt, dern konnte
der Strom abgestellt werden.
Das E-Werk wies diese ersten Verbraucher ausdrücklich darauf hin,
daß bei einer Erwärmung der Leitungsdrähte sofort die Sicherung
herauszunehmen ist. Trotzdem wurden gerade in dieser Anfangszeit die Leitungen
infolge Uberlastung des öfteren zerstört, nicht zuletzt deshalb,
weil häufig geflickte Sicherungen die Drähte überlasteten.
Meist ging es glimpflich ab, aber einige Brandfälle gab es doch. Über
Todesfälle durch Stromstoß ist nichts bekannt.
Auf das einfache Volk kam viel Neues zu; für manche zu viel. Es
gab Fragen über Fragen: Was darf man anfassen? Wo droht besondere
Gefahr?
Trotz allem haben sich die Leute schnell an den größeren
Komfort und die Arbeitserleichterung gewöhnt.
Zum Stromanschluß Brettachs meldete damals die Neckar-Zeitung folgendes:
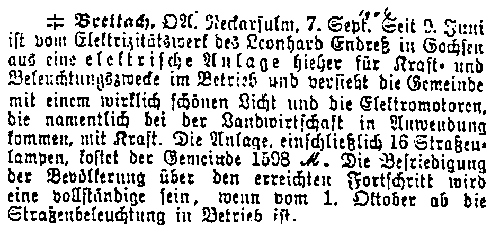
Der "Edison" - Oder: Wie man das E-Werk beschummelt
Trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten brachte der elektrische
Strom dem bäuerlichen Volk mehr Annehmlichkeit und Arbeitserleichterung:
Beleuchtung in den Straßen, im Haus, im Stall, in der Scheune und
in den Werkstätten, Elektromotoren für die bislang handbewegten
Maschinen, Arbeitshilfen im Haushalt.
Auf viele bargeldarme Bauern und Kleinhandwerker, auf die Selbstversorger,
kamen neue Belastungen zu. Wehe, es ließ jemand das Licht unnötig
lange brennen. Dann gab's Schelte. Wir Heutigen müssen das Energiesparen
- aus anderen Gründen - erst wieder lernen.
Sehr bald nach der Elektrifizierung haben überall die pauschal
angeschlossenen Verbraucher versucht, die E-Werke zu beschummeln. Nicht
dass sie die Anzahl der Brennstellen erhöhten; das wäre dem monatlich
erscheinenden Kontrolleur sofort aufgefallen. Es gab andere Tricks. Dazu
ein Beispiel, bestätigt von Harald Endreß, dem Enkel von Leonhard
Endreß:
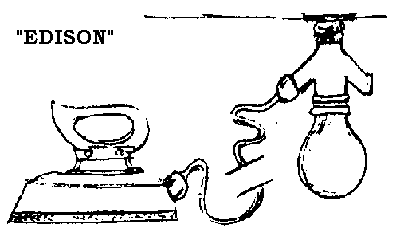
In dieser
Anfangszeit gab es noch ganz wenige Steckdosen in den Häusern, denn
auch für diese "Zapfstelle" mußte pauschal bezahlt werden, zusammen
mit den Elektrogeräten. Aber wie überlistete man das E-Werk?
Ganz einfach. Man kaufte mit den Nachbarn zusammen z.B. ein elektrisches
Bügeleisen - eine große Arbeitserleichterung gegenüber
dem schweren Kohleeisen - und besorgte sich am E-Werk vorbei einen sogenannten
"Edison". Wie sieht so ein "Edison" aus? Nun, es ist ein Porzellankörper
mit einem Glühbirnengewinde, einer Glühbirnenfassung und zwei
Steckdosen, alles in einem Gerät. Das Glühbirnenaußengewinde
wird in die Deckenlampenfassung eingeschraubt, nach unten weist jetzt die
Glühbirnenfassung. An zwei gegenüberliegenden Seiten befinden
sich, leicht nach unten geneigt, zwei Steckdosen. Man schraubt die an der
Deckenlampe zuvor entfernte Glühbirne in den "Edison" ein und setzt
diesen in die Deckenlampenfassung. Man hat damit Beleuchtung und zwei Steckdosen.
Nun konnte die Hausfrau z.B. Wäsche bügeln. Das Gemeinschaftsbügeleisen
machte am Abend, wenn man sicher war, dass kein Kontrolleur mehr kam, in
der Nachbarschaft die Runde. Auch andere tagsüber versteckte Geräte
wurden ausgerechnet abends in der Spitzenverbrauchszeit benützt.
Der Kraftwerksbetreiber wunderte sich über den hohen abendlichen
Strombedarf. Man kam den "Sündern" aber bald auf die Schliche und
drohte mit der Installation eines Zählers, was mit Kosten verbunden
war. Strafrechtliche Maßnahmen waren ein weiteres Druckmittel. Es
war übrigens verboten, abends nach Einbruch der Dunkelheit die E-Motoren
zu betreiben, weil sonst das Licht flackerte. Auch dieses Verbot wurde
häufig übertreten, weil halt abends die Futterschneidmaschine
gebraucht wurde.
Ein seltenes Dokument, nämlich der Ausschellzettel für den
Polizeidiener (Büttel), auf dem die Bekanntmachung steht, daß
der Kraftwerksbetreiber Endreß strafrechtlich gegen den Stromklau
vorgehen werde, ist im Archiv erhalten. Zweimal, einmal 1908 und noch einmal
1912 mußten alle am E-Werk Gochsen angeschlossenen Gemeinden ausschellen
lassen, daß Stromklau kein Kavaliersdelikt ist. Manche naive Zeitgenossen
meinten halt, das Kocherwasser treibe die Turbinen doch sowieso an.
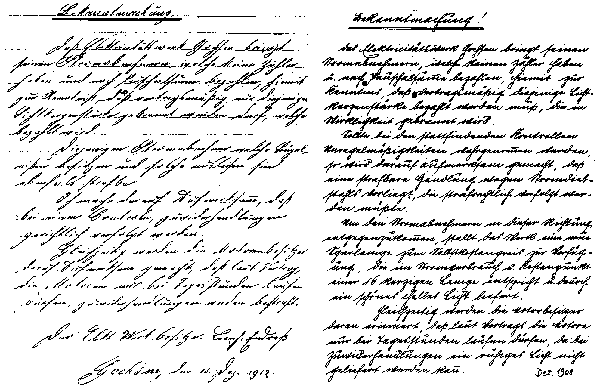
Das Elektrizitätswerk Gochsen bringt seinen Stromabnehmern,
welche keine Zähler haben und nach Pauschalsumme bezahlen, hiermit
zur Kenntnis, daß vertragsmäßig nur diejenige Lichtkerzenstärke
gebrannt werden darf, welche bezahlt wird Diejenigen Stromabnehmer, welche
Bügeleisen besitzen und solche ausleihen, sind ebenfalls strafbar.
Ich mache darauf aufmerksam, daß bei einer Kontrolle Zuwiderhandlungen
gerichtlich verfolgt werden. Gleichzeitig werden die Motorenbesitzer darauf
aufmerksam gemacht, daß laut Vertrag die Motoren nur bei Tagesstunden
laufen dürfen, Zuwiderhandlungen werden bestraft.
Der Elektrizitätswerkbesitzer Leonhard Endreß;
Gochsen, den 13.Dez. 1912
Ein Leben ohne elektrischen Strom ist heute undenkbar. Wir Wohlstandsbürger,
von der Technik verwöhnt, nutzen in allen Lebensbereichen diese saubere
Energieform, meist ohne darüber nachzudenken, wieviel Erfindergabe
und Entwicklungsarbeit nötig waren, um in Wohlstand und Luxus leben
zu können.
aus "Rückblicke" des Heimatgeschichtlichen Vereins Langenbrettach
e.V. [Nr.64-67]
Verfasser: Herbert Schlegel
Zeichnungen: Barbara Schlegel
Auskünfte: Harald Endreß und Adolf Simpfendörfer